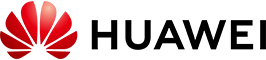Studie: Warum digitale Infrastruktur und Künstliche Intelligenz über unsere Wettbewerbsfähigkeit entscheiden
Ob mit neuen Produkten, Services oder Geschäftsmodellen: Um am weltweiten Wachstum teilhaben und wettbewerbsfähig bleiben zu können, sind intelligente digitale Infrastrukturen und Künstliche Intelligenz (KI) unumgänglich. Der Huawei Global Connectivity Index (GCI) 2018 zeigt, wie Konnektivität und KI zusammenhängen, wer vom KI-Boom profitieren wird und was ihn gefährden könnte.
Ökonomischer Paradigmenwechsel
Vom autonomen Fahren über Chatbots im Kundenservice und fehlerfreie Spracherkennung bei internationalen Meetings bis hin zur Krebsbekämpfung in der medizinischen Forschung: Unser Leben und Arbeiten werden in Zukunft immer stärker durch digitale Dienstleistungen, Produkte und Geschäftsmodelle geprägt, die konsequent die Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz (KI) ausschöpfen. KI wird damit zum Haupttreiber eines globalen ökonomischen Paradigmenwechsels. Und wird als Motor für das Wachstum einzelner Branchen, aber auch einer dafür notwendigen Entwicklung einer intelligenten Konnektivität wesentlich dazu beitragen, den Anteil der Digital-Ökonomie am weltweiten Bruttosozialprodukt im Jahr 2025 auf knapp 23 Billionen Dollar fast zu verdoppeln. Zu diesem Ergebnis kommt der Global Connectivity Index (GCI) 2018 von Huawei. Der GCI misst anhand von 40 Kriterien in mittlerweile 79 Ländern weltweit die Entwicklung von Investitionstätigkeiten in Kommunikationstechnologie, Anwendungen, Nutzererfahrung und Marktentwicklung und deren Auswirkung auf den digitalen Reifegrad ihrer Wirtschaft. Deutschland landet 2018 auf Rang 14.
– Kevin Zhang, Präsident Huawei Corporate Marketing
Intelligente Vernetzung: unverzichtbare Basis
Der GCI, 2018 zum fünften Mal erhoben, zeigt: Unabdingbare Voraussetzung einer Volkswirtschaft, ihrer Industrien und Unternehmen, sich dieses digital basierte Wachstum zu erschließen, sind möglichst flächendeckende intelligente Telekommunikationsnetze. Heißt: KI definiert als ökonomischer Wachstumstreiber Nummer eins neu, wie eine wettbewerbsrelevante Konnektivität aussieht. Intelligente Vernetzung wird damit zur unverzichtbaren Basis für den Wohlstand ganzer Volkswirtschaften, für Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität jedes Unternehmens.
Wer profitiert, wer verliert?
Profitieren werden von dieser Entwicklung also in erster Linie diejenigen Unternehmen und Länder, die auf eine hochwertige digitale Infrastruktur zurückgreifen können. Industrien, die KI in Schlüsseltechnologien einbinden, also etwa in den Bereichen Breitbandversorgung, Rechenzentren, Cloud, Big Data und Internet der Dinge, werden eine neue Welle des Wirtschaftswachstums auslösen.
Was eine KI-basierte Wirtschaft braucht
Laut GCI bilden vor allem drei Faktoren die Basis für Wettbewerbsfähigkeit in einer digitalen, von KI geprägten Ökonomie an der Schwelle zu einem neuen Zyklus globalen Wirtschaftswachstums.
Relevante Algorithmen
Sie bilden die Gene jeder KI. Ohne hochwertige Algorithmen sind KI-Anwendungen sinnlos. Das macht KI-Experten für Unternehmen unverzichtbar. Sie sind in der Lage, die relevanten Felder für KI-Anwendungen zu identifizieren, die dafür passenden Algorithmen zu bestimmen und neue zu entwickeln.
Viele klassifizierte Daten
Daten sind das Lehrmaterial: Ohne sie kann eine KI-Anwendung niemals gelingen – egal, wie gut die Gene respektive die Algorithmen auch sein mögen, die ihr zugrunde liegen. Nur auf der Grundlage riesiger, korrekt zugeordneter Datenmengen kann es gelingen, das Leistungspotenzial von KI vollständig auszuschöpfen. So war beispielsweise Googles Computerprogramm AlphaGo in erster Linie aus dem Grund in der Lage, Menschen im Brettspiel Go zu besiegen, weil es eines Tages einfach über mehr Erfahrung in Form endloser Trainingseinheiten verfügte, als es einem Menschen jemals möglich wäre. Und Google brauchte zehn Jahre sowie Hunderttausende Stunden Training, um relevante Fortschritte im autonomen Fahren zu erzielen, ohne damit schon ans Ziel gekommen zu sein. Also deutlich länger, als etwa ein professioneller Fahrer bräuchte, um sein Niveau zu halten oder zu verbessern.
Hohe Rechenleistung
Ein Kind kann noch so talentiert und mit den besten Lehrmaterialien versorgt sein – herausragende Leistungen wird es nur dann erbringen, wenn es ausdauernd und intensiv übt. Heißt: Auch mit den besten Algorithmen und riesigen Datenmengen wird ein KI-Modell nur erfolgreich sein, wenn eine ausreichend hohe Rechenleistung zur Verfügung steht, um diese Trainings zu ermöglichen. Und im Vergleich zu traditionellem Programmieren braucht KI eine deutlich höhere Rechenkapazität. Weil die Trainings zeitaufwändig sind. Weil Experten die Algorithmen den neuen Erkenntnissen aus den vorangegangenen Trainings anpassen und das Modell weiter trainieren müssen, um es kontinuierlich zu verbessern. Wie bei einem Spitzenathleten muss die Zahl dieser Trainings exponentiell zunehmen, um Fortschritte auf hohem Niveau möglich zu machen. Ist das Training abgeschlossen, gilt es, das Modell in möglichst viele Anwendungsszenarien herunterzubrechen. Je nach Phase schwankt der Bedarf an Rechenkapazität und die Anforderung an Datensicherheit – wovon jeweils abhängt, ob sich für Unternehmen eher anbietet, Kapazitäten über Public oder Private Clouds zu beziehen oder auf eigene Hardware zu setzen.
Deutschland: für die digitale Zukunft noch nicht optimal gerüstet
Der GCI zeigt auch: Deutschland ist für eine Zukunft, in der es entscheidend auf intelligente Konnektivität und Künstliche Intelligenz ankommt, noch nicht optimal gerüstet. Im diesjährigen GCI-Ranking landet der derzeitige Vize-Exportweltmeister nur auf Rang 14, ist damit gegenüber dem Vorjahr um zwei Plätze abgerutscht und liegt aktuell hinter Luxemburg und nur knapp vor Neuseeland. Und deutlich hinter dem Spitzentrio USA, Singapur und Schweden.
Digitale Ausbildung neu definieren
Welches Land künftig zu den wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften zählen wird, hängt auch weiterhin stark vom Faktor Mensch ab. In einer von Künstlicher Intelligenz geprägten Arbeitswelt wird digitale Kompetenz zur entscheidenden Größe – ist derzeit aber noch vergleichsweise rar gesät. Unternehmen und Regierungen müssen also die Ausbildung für eine Arbeitswelt, die von KI neu definiert wird, radikal reformieren. Sie müssen zudem mit dem Aufbau eines gesunden kollaborativen und offenen KI-Ökosystems beginnen, um wettbewerbsfähige KI-Talente anzuziehen und zu halten. Ähnlich wie für die Anforderungen an KI-Anwendungen selbst heißt das auch für KI-Entwickler: viel Zeit für Trainings, große Mengen an verlässlichen Daten, passende Entwickler-Tools und ausreichend Rechenkapazitäten.